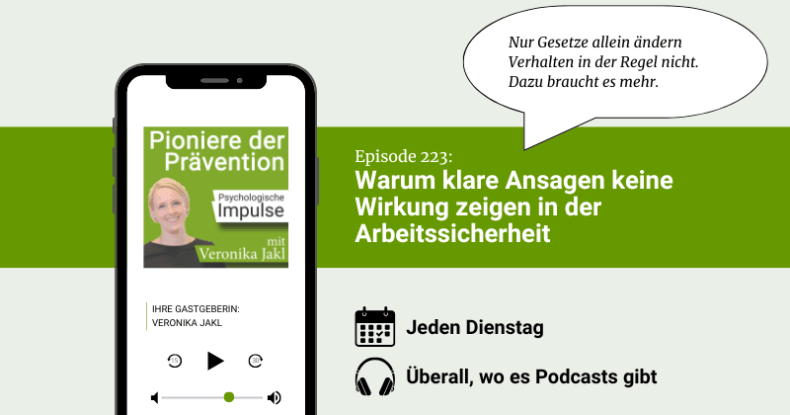Nicht jede klare Anweisung führt automatisch zu sicherem Verhalten.
Gerade in der betrieblichen Prävention zeigt sich immer wieder: Wer nur auf Vorschriften pocht, stößt oft auf Widerstand oder Gleichgültigkeit. Die Gründe dafür sind vielfältig – mangelndes Vertrauen, fehlende Beteiligung oder unterschiedliche Perspektiven auf Sicherheit im Arbeitsalltag. In dieser Episode werfen wir einen genauen Blick darauf, warum Kommunikation weit mehr ist als das Weitergeben von Regeln.
Ich teile mit Ihnen Erfahrungen aus meiner Ausbildung mit angehenden Sicherheitsfachkräften, unter anderem den kritischen Einwand eines Teilnehmers, der klare Ansagen für den einzig wirksamen Weg hielt. Doch wissenschaftliche Studien zeigen: Wer sich ausschließlich auf Druck und Kontrolle verlässt, scheitert häufig an der Realität betrieblicher Dynamiken. Echte Verhaltensänderung entsteht dort, wo Vertrauen wächst – und das gelingt durch eine Haltung, die Zuhören, Nachfragen und Mitgestalten zulässt.
Außerdem geht es um uns selbst: Unsere eigene psychische Verfassung beeinflusst stark, wie wir kommunizieren. Wer gestresst ist, greift eher zu autoritären Strategien – auch wenn diese selten nachhaltig sind. Ich zeige Ihnen, wie Sie auch in schwierigen Gesprächen souverän bleiben, Ihre Haltung reflektieren und so die Weichen für mehr Beteiligung und Eigenverantwortung stellen können.
Lieber lesen als anhören?
In meiner Arbeit mit Sicherheitsfachkräften begegnet mir immer wieder eine zentrale Frage: Warum können wir nicht einfach klare Anweisungen geben und erwarten, dass sie befolgt werden? Schließlich geht es doch um Sicherheit, um Vorschriften, um das Richtige. Und trotzdem stoßen viele auf Widerstand, auf zögerliche Umsetzung oder auf offene Ablehnung. Warum ist das so?
In diesem Blogartikel möchte ich mit Ihnen teilen, welche Rolle unsere Haltung, unsere Kommunikationstechniken und unsere eigene psychische Verfassung in schwierigen Gesprächen spielen – und warum ein echtes Gespräch oft wirksamer ist als eine Ansage von oben.
Warum klare Ansagen nicht ausreichen
Viele Sicherheitsfachkräfte bringen viel Erfahrung mit – sowohl im Beruf als auch im Umgang mit Vorschriften. Umso verständlicher ist es, dass einige skeptisch reagieren, wenn ich in Trainings zur Gesprächsführung vorschlage, statt klarer Anweisungen lieber Fragen zu stellen oder zuzuhören.
Ein Teilnehmer formulierte es so:
„Warum soll ich so tun, als könnten die sich alles aussuchen und ich frage nur nett? Das ist doch Blödsinn! Es ist halt Vorschrift!“
Diese Haltung ist nachvollziehbar. Doch Studien zeigen, dass allein auf Vorschriften zu pochen selten zu echtem Verhaltenswandel führt. Besonders dann nicht, wenn Beschäftigte der Quelle – also uns als Fachkräfte – nicht ausreichend vertrauen oder uns nicht als glaubwürdig wahrnehmen.
Vertrauen als Schlüssel zur Veränderung
Vertrauen ist ein zentrales Element in der Kommunikation. Erst wenn mein Gegenüber mir als Person zutraut, dass ich kompetent und wohlwollend handle, wird meine Botschaft wirklich ernst genommen.
Gerade in der Arbeitssicherheit geht es oft um mehr als akute Gefahren. Es geht um neue Prozesse, um Verhaltensänderungen, um Rückmeldungen zur Nutzung von Schutzausrüstung oder um Diskussionen mit Führungskräften über Ressourcen. Diese Themen sind komplex, nicht immer gibt es eindeutige Regeln. Und genau deshalb brauchen sie Dialog statt Monolog.
Die Haltung des Nichtwissens
Eine der wirksamsten Herangehensweisen in der Beratung ist die sogenannte „Haltung des Nichtwissens“. Sie bedeutet nicht, dass ich keine Expertise habe. Sondern dass ich – trotz meiner Expertise – offen und neugierig bleibe gegenüber meinem Gegenüber. Ich traue der anderen Person zu, eigene Lösungen zu finden. Ich höre zu, stelle Fragen, begleite.
Diese Haltung fällt vielen schwer. Sie wirkt im ersten Moment vielleicht weniger autoritär – ist aber langfristig deutlich nachhaltiger, weil sie Beteiligung fördert und echte Eigenverantwortung möglich macht.
Belastung verändert unser Kommunikationsverhalten
Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung: Wenn ich gestresst bin, wünsche ich mir klare Strukturen und einfache Umsetzungen. Die Sifa-Langzeitstudie zeigt, dass dieser Wunsch nach Kontrolle und Vorschriften mit der eigenen Belastung steigt. Dann erscheinen Anweisungen einfacher, weil sie schnell und eindeutig sind.
Doch genau hier liegt die Gefahr: Wenn wir nur durchgreifen, bleibt die Verantwortung allein bei uns. Wir wollen aber, dass Beschäftigte Verantwortung mittragen. Dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeit geben, sich einzubringen.
Diskussion ist kein Zeichen von Unsicherheit
Diskussion bedeutet nicht, dass ich meine Position aufgebe. Sie bedeutet, dass ich meinem Gegenüber Verantwortung zutraue. Wer gefragt wird, wer mitentscheiden darf, der fühlt sich ernst genommen – und ist eher bereit, sich auch an Vereinbarungen zu halten.
Denn echte Beteiligung schafft Verständnis und Engagement. Und genau das brauchen wir in der Prävention.
Mein Praxistipp für Sie
Probieren Sie es aus: Achten Sie bei einem Ihrer nächsten Gespräche bewusst darauf, wie oft Sie Fragen stellen statt Anweisungen zu geben. Reflektieren Sie danach: Wie hat Ihr Gegenüber reagiert? Welche Wirkung hatte das auf die Gesprächsdynamik?
Sie werden erstaunt sein, wie viel sich verändert, wenn wir bereit sind, weniger zu sagen – und mehr zuzuhören.
Nützliche Links
Sie wollen sich tiefer mit dem Thema beschäftigen? Dann schauen Sie mal hier:
Podcast abonnieren, um nichts mehr zu verpassen:
Die Akademie ist Kurs-Bibliothek und Netzwerk für ExpertInnen in der betrieblichen Prävention.
Der Mitgliederbereich ist vollgepackt mit Online-Kursen, Webinaren und Leitfäden rund um die Selbstständigkeit in Arbeitssicherheit, BGM, Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie.
Das Highlight ist der regelmäßige Austausch in der Gruppe und mit Veronika Jakl - live bei den monatlichen Stammtischen und jederzeit im Forum.